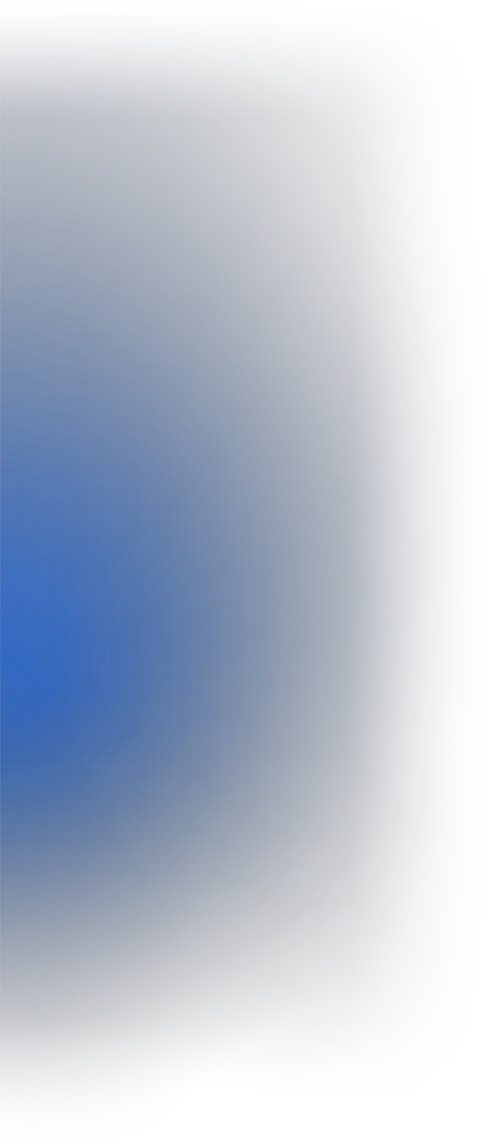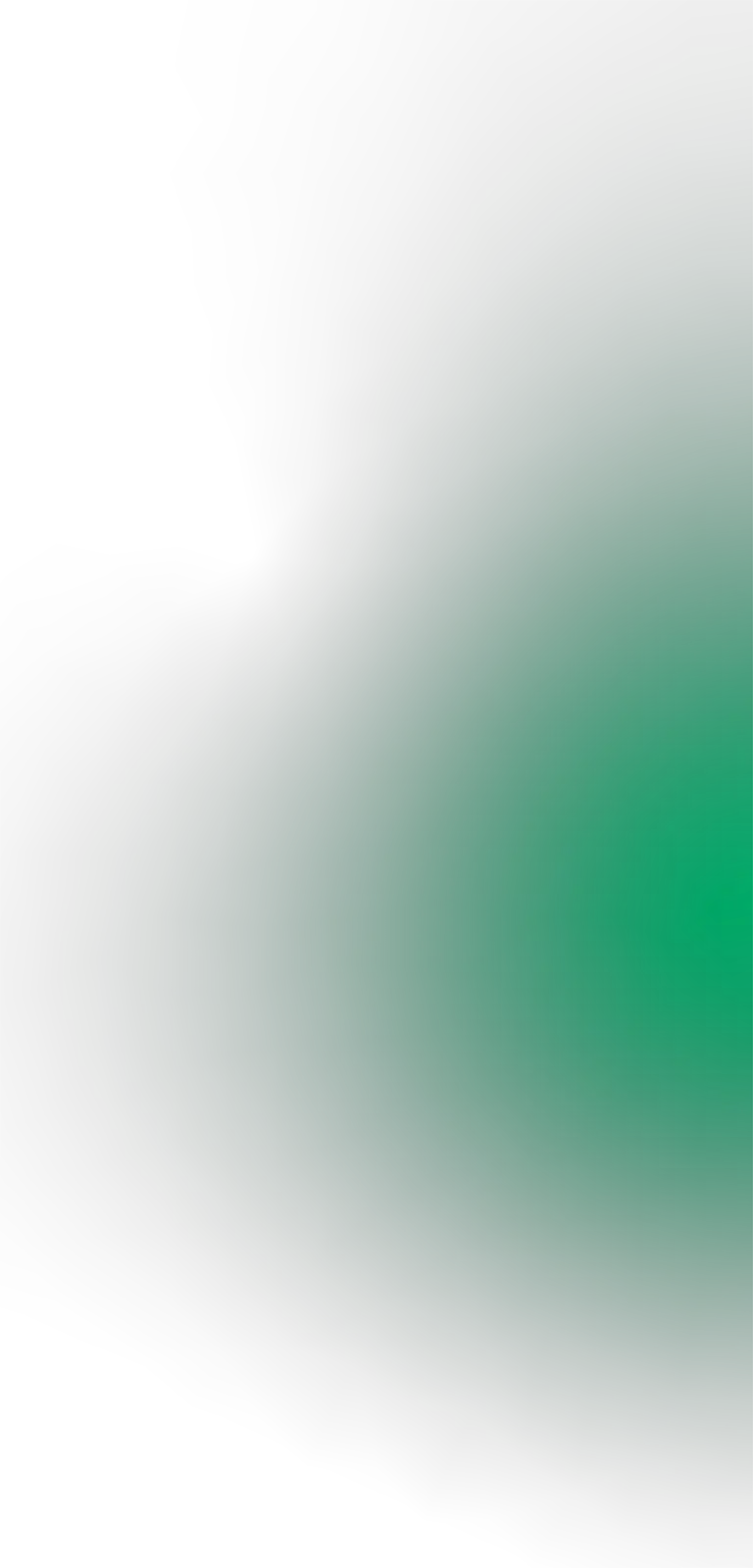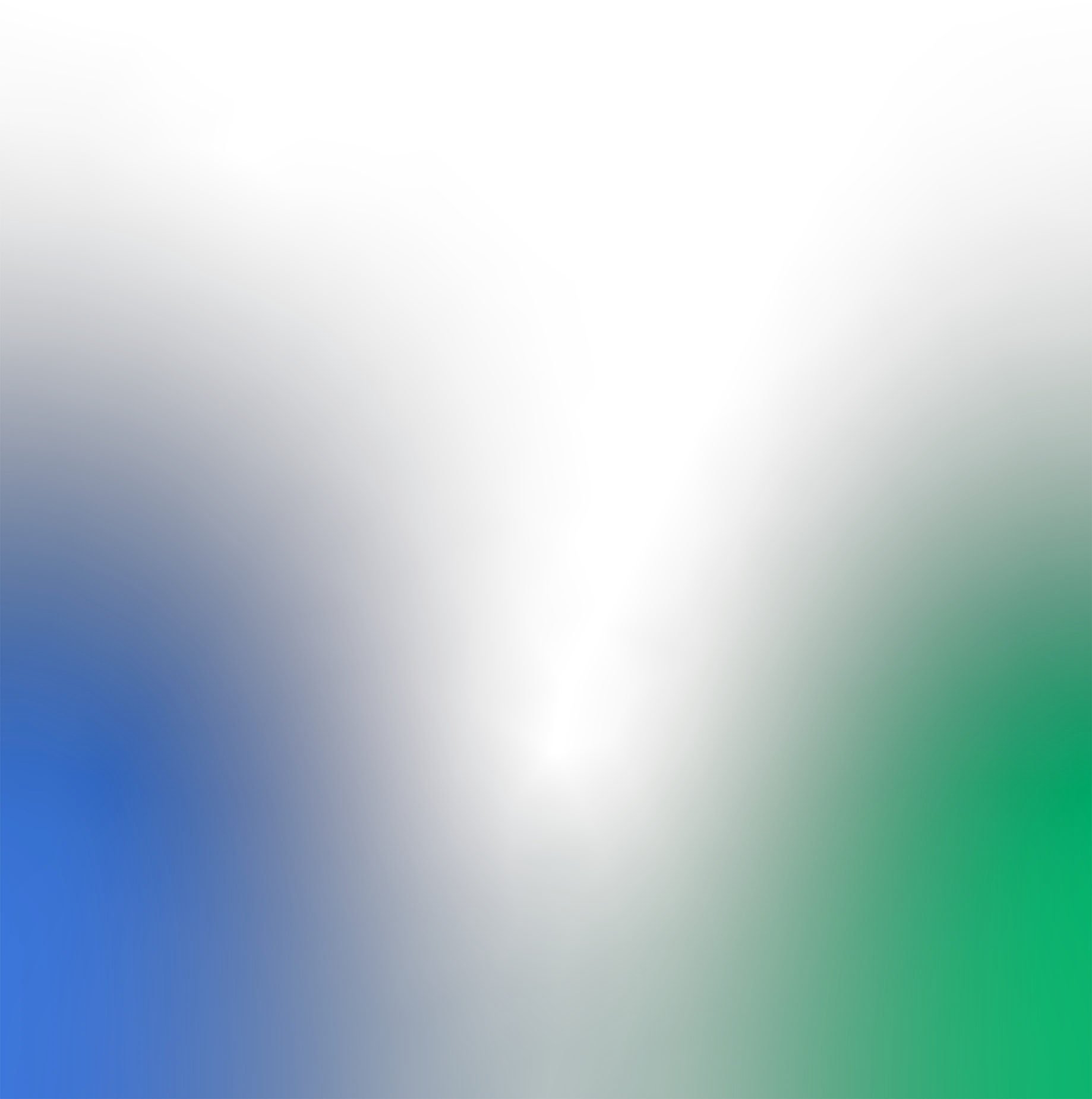CII-Whitepaper: Hindernisse auf dem Weg zu einer souveränen Cloud-Infrastruktur der deutschen Verwaltung
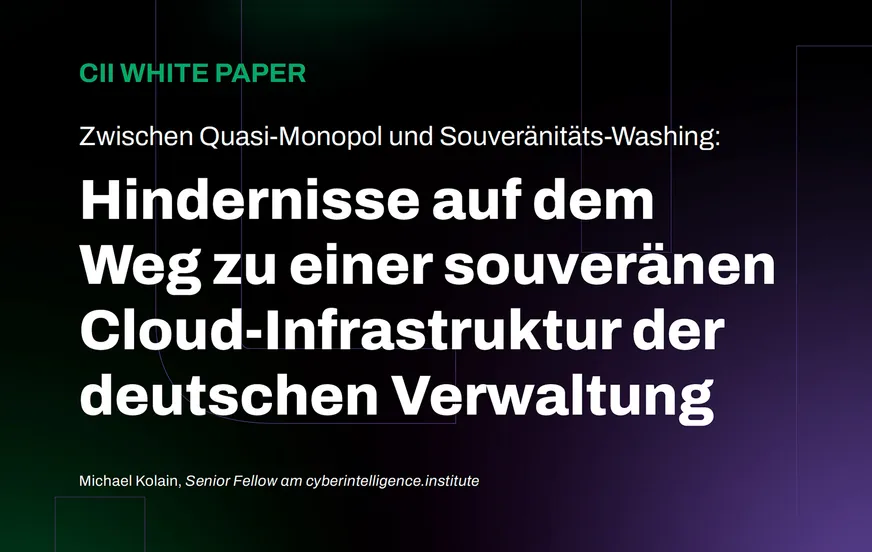
Digitale Souveränität als zentrale Herausforderung
Die digitale Souveränität der öffentlichen Verwaltung in Deutschland steht vor erheblichen strukturellen Herausforderungen. In zentralen Bereichen ihrer Informations- und Kommunikationstechnologie ist sie faktisch von Produkten und Dienstleistungen des US-amerikanischen Konzerns Microsoft abhängig. Ursächlich sind laut Paper gezielte Lock-In-Effekte und Produktbündelungen, die die Wahlfreiheit der öffentlichen Hand faktisch aushebeln, mit erheblichen Beeinträchtigungen der Kostenkontrolle, Cybersicherheit und digitalen Souveränität. Auf diese Weise konnte Microsoft eine Quasi-Monopolstellung im öffentlichen Sektor etablieren, die offenen und fairen Wettbewerb im europäischen Cloud-Markt erheblich behindert.
Die starke Marktdominanz hat weitreichende Folgen: Sie schränkt die Wahlfreiheit öffentlicher Einrichtungen ein, erhöht Sicherheitsrisiken, mindert Transparenz und reduziert die finanzielle Steuerungsfähigkeit staatlicher Haushalte. Hinzu kommt der Lock-in-Effekt: Proprietäre Standards, die enge Verzahnung von Client-, Server- und Cloud-Strukturen sowie hohe Migrationskosten erschweren den Wechsel zu alternativen Lösungen erheblich. Dadurch werden vorhandene, digitalsouveräne Alternativen trotz technischer Reife und Markterfahrung praktisch chancenlos.
Ursachen und Mechanismen der Microsoft-Dominanz
Plattform- und Lock-in-Effekte
Die herausragende Marktstellung Microsofts im öffentlichen Sektor basiert auf der strategischen Integration verschiedener Software- und Cloud-Komponenten. Durch die Verknüpfung von Betriebssystem, Office-Anwendungen und Cloud-Diensten entsteht ein geschlossenes Ökosystem, das Wechselbarrieren systematisch erhöht. Insbesondere der hohe Aufwand bei Datenmigration und Anpassung von Arbeitsprozessen führt dazu, dass Verwaltungen häufig im Microsoft-Universum verbleiben.
Preis- und Produktpolitik als Steuerungsinstrument
Die dynamische Preisgestaltung und das gezielte Product-Bundling begünstigen zusätzlich den Erhalt der Marktdominanz. Produkte wie Microsoft Teams werden oftmals als Bestandteil größerer Lizenzpakete bereitgestellt, was interoperable Alternativen aus dem Markt drängt. Entscheidungen über Cloud-Nutzung und Softwarearchitektur entstehen so weniger aus strategischer Planung heraus als vielmehr aus ökonomischem und organisatorischem Zugzwang.
Kritikpunkte an der Nutzung proprietärer Systeme
Fehlende Kontrolle und Sicherheitsrisiken
Ein wesentlicher Kritikpunkt am Einsatz Microsofts in der öffentlichen Verwaltung liegt im Mangel an technischer und rechtlicher Kontrolle über die Software. Der Quellcode ist nicht offen einsehbar, wodurch Sicherheitsüberprüfungen und Nachvollziehbarkeit der Datenverarbeitung erschwert werden. Zudem bestehen Risiken im Bereich der Cybersicherheit, da Sicherheitsvorfälle und Datenabflüsse in proprietären Systemen schwerer nachvollzogen und eigenständig behoben werden können.
Fragwürdige Vereinbarkeit mit Datenschutz und Rechtsnormen
Die Nutzung cloudbasierter Microsoft-Dienste wirft zudem rechtliche Fragen auf, insbesondere im Hinblick auf den Datenschutz und die Datenübermittlung in Drittländer. Trotz wiederholter Anpassungen und Compliance-Bemühungen bleibt unklar, ob die Verarbeitung sensibler Verwaltungsdaten mit europäischen Datenschutzstandards vollständig vereinbar ist.
Souveränitäts-Washing und Grenzen vermeintlicher Alternativen
Microsoft reagiert auf die öffentliche Kritik durch verschiedene Produktanpassungen und Kommunikationsstrategien, die den Eindruck eines verstärkten Engagements für Datenschutz und digitale Souveränität vermitteln sollen. In der Praxis führen diese Maßnahmen jedoch nicht zu einer substantiellen Unabhängigkeit der Nutzerinnen und Nutzer. Vielmehr vertiefen sie die bestehende Bindung an das geschlossene Ökosystem des Konzerns, indem sie neue Abhängigkeiten schaffen und die technologische Eigenständigkeit weiter einschränken. Die Fähigkeit Microsofts, Vertragsbedingungen und Lizenzmodelle einseitig zu gestalten, bleibt ungebrochen.
Wege aus der Abhängigkeit
Übergangsphase und politische Verantwortung
Die aktuelle Rahmenvereinbarung des Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI) mit Microsoft, die bis 2028 läuft, sollte als Übergangsphase genutzt werden, um eine schrittweise Reduktion monolithischer IT-Abhängigkeiten vorzubereiten. Ziel ist der Aufbau einer eigenständigen, europäischen Cloud- und Software-Infrastruktur, die auf Offenheit, Interoperabilität und Transparenz basiert.
Rechtliche und wirtschaftliche Maßnahmen
Kartellrechtliche Prüfverfahren sollten Lizenz- und Bündelpraktiken systematisch untersuchen und gegebenenfalls durch aufsichtsrechtliche Maßnahmen begrenzen. Parallel dazu sind politische und wirtschaftliche Initiativen erforderlich, um Multicloud-Strategien zu fördern, die Flexibilität und Innovationskraft erhöhen. Wettbewerbsbehörden müssen gezielt gegen marktverzerrende Praktiken wie diskriminierende Preisgestaltung und Produktbündelung vorgehen.
Vorbildfunktion und Investitionen
Der Staat trägt eine besondere Verantwortung, durch sein eigenes Beschaffungswesen Impulse für mehr digitale Souveränität zu setzen. Dies umfasst die Förderung offener Standards, interoperabler Schnittstellen sowie langfristige Investitionen in europäische Cloud-Infrastrukturen. Ergänzend sollten klare Anforderungen an Transparenz, Governance und strategische Bedarfsanalysen für IT-Ausgaben in Behörden formuliert werden.
Perspektiven für eine souveräne Verwaltungs-IT
Kurzfristig gilt es, die Kosten öffentlicher IT-Beschaffung engmaschig zu überwachen und Studien zur Erhöhung der Wahlfreiheit in einzelnen Produktbereichen zu initiieren. Mittelfristig sollten zukünftige Rahmenverträge mit Microsoft die Möglichkeit zur Auswahl zwischen alten und neuen Produktgenerationen sowie die Verpflichtung zu offenen Schnittstellen vorsehen. Langfristig muss das Ziel in einer vollständigen Ablösung des Microsoft-Ökosystems bestehen, um eine souveräne, interoperable und zukunftsfähige IT-Arbeitsumgebung für die Verwaltung zu schaffen.